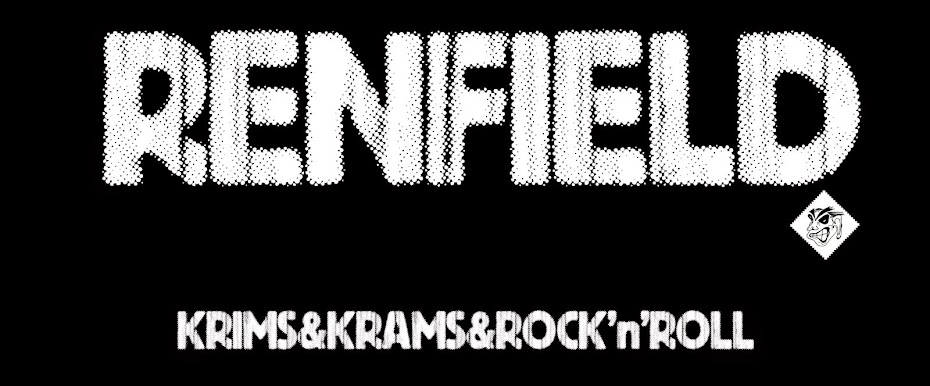Supermolly, Tommy-Haus und Schokoladen - für Konzertgänger sind das feste Einrichtungen im Kulturleben von Friedrichshain, Kreuzberg und Mitte. Den meisten wird auch irgendwie klar sein, dass es sich bei diesen Clubs um selbstverwaltete Projekte handelt oder dass sie ihren Ursprung als besetzte Häuser haben.
In der geographischen und zeitlichen Wahrnehmung werden Squats in Berlin oftmals in die oben genannten Bezirke beziehungsweise in dn 70er bis 90er Jahre verordnet - und gehören somit schon ein wenig zur Berliner Historie. Aber die Besetzung von Raum, privat der öffentlich, ist nicht nur was für 80er-Jahre-Nostalgiker oder Geschichtsbücher, sondern finden immer noch hier und jetzt statt. Jüngstes Beispiel ist das Refugee-Camp am Oranienplatz und die anschließende Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule.
Allerdings wird auch die Tatsache, dass in vielen anderen Gegenden Berlins immer wieder Besetzungen durchgeführt wurden, oft vergessen. Eine Übersicht über die existierenden und vergangenen Besetzungen der Stadt fehlte bisher. Grund genug für das PAPPSATT MEDIENKOLLEKTIV, im Sommer 2014 die interaktive Homepage „berlin-besetzt.de“ online zu stellen, auf der man sich über die Geschichte der Hausbesetzungen der letzten 30-40 Jahre im gesamten Berliner Stadtgebiet informieren kann. Über die Hintergründe dieses virtuellen Squatting-Stadtführers gab der Initiator der Seite, Toni Grabowski, gern Auskunft - natürlich passend zwischen Südblock und „Kotti & Co.“ am Kottbusser Tor in Kreuzberg.
Gary (G.): Hallo Toni, Ich weiß nicht mehr genau, wann ich zum ersten Mal auf Berlin-besetzt.de gestoßen bin, weiß aber, dass die Seite in den Wochen, seit sie online gegangen ist, in den Medien sehr präsent war. Hat dich dieses Medienecho überrascht?
Toni Grabowski (TG): Mich hat es schon überrascht, welche Kreise das gezogen hat. Es hat mich nicht überrascht, dass es ein großes Echo gab. Weil ich das Projekt ja selber gemacht habe, habe ich selber gemerkt, dass es eine Riesenlücke in der Aufarbeitung der Hausbesetzergeschichte gibt.
Aufgrund dieser Lücke habe ich damit überhaupt angefangen. Weil ich dachte, dass es ja nicht sein kann, das es da nichts gibt. Letztendlich ist das ja ein wahnsinniges Stück Berlingeschichte, bei dem auch unglaublich viele Leute involviert waren. Ich habe mal zum Spaß hochgerechnet: Wenn ich allein alle Leute nehme, die halt in irgendeiner Weise mal persönlich was mit besetzten Häusern zu tun gehabt haben, und davon jeder einmal auf die Seite klickt, dann ist das schon eine astronomische Zahl.
G.: Aber wie bist du denn dann auf diese Lücke in der Berliner Stadtgeschichte gestoßen?
TG: Dadurch, dass ich in einer linken Szene aufgewachsen bin und mich dort auch bewege. Es ist wohl schon ein Fakt, dass ein Großteil dieser Szene, die wir haben in Berlin, durch Besetzungen entstanden ist. Vielleicht nicht entstanden, aber ein Großteil der Infrastrukturen, die wir nutzen, kommt schon von Besetzungen her. Die ganzen Haus- und Kulturprojekte, die es so gibt. Selbst wenn sie nicht besetzt waren, haben sie direkt mit Hausbesetzungen zu tun. Es ist überall präsent, gleichzeitig war dieses Thema schon da.
Letztendlich war der Anlass die Karte zu machen, dass ich mich mit Landkarten, Karten als politisches Instrument und DIY-Karten beschäftigt habe. Dann war da auch die fixe Idee, schnell die besetzten Häuser zusammenzutragen und die in eine Karte einzutragen, und gut ist die Sache. Es war eigentlich nicht mehr als so etwas gedacht. Dann wollte ich recherchieren und habe festgestellt, dass es keinerlei Listen gibt. Es gibt ein paar aus den 80ern, vereinzelt aus den 90ern, aber bei weitem nicht vollständig und auch nicht von beiden zusammen.
G.: Du sagst, es gab da ein paar Listen, aber das klingt, als wäre das eine sehr mühselige Arbeit gewesen. Wie hast du die Informationen denn zusammengetragen? Hast du da nur vorm Rechner gesessen oder bist du da auch vor Ort gewesen und hast dir besetzte oder ehemals besetzte Häuser angeschaut?
TG: Teils, teils. Mit Unterbrechungen läuft das Projekt seit fünf Jahren. Am Anfang stand das Papiertiger-Archiv. Die sammeln seit Ende der 70er alles zu den sozialen Bewegungen in Berlin, Schwerpunkt auch die Hausbesetzerzeiten der 80er, die haben wahnsinnig viel Material. Die haben angefangen mit so einer Liste, aber nur sehr rudimentär. Ich bin dann die ganzen Szenepublikationen durchgegangen, Flyer, Szene-Zeitschriften wie die Instandbesetzerpost, Broschüren, vereinzelt Bücher. Bin systematisch alles durchgegangen, habe viel gescannt, und alle Daten rausgeschrieben und in einer riesigen Excel-Datei angelegt.
G.: Bist du denn auch direkt zu irgendwelchen Adressen hin gegangen um zu schauen, ob es da noch ein besetztes Haus gibt und wie das jetzt aussieht?
TG: Ich fotografiere auch nebenbei soziale Bewegungen in Berlin. Von daher beobachte ich eh auch die Szene, und was darin passiert, und bin auch während des Projekts durch die Straßen gelaufen, habe viele Leute befragt und Kontakte zu Hausprojekten geknüpft. Da kamen auch noch viele Korrekturen und Ergänzungen.
Ich bin auch später zu einem Kollektiv gestoßen, SqEK-Squatting Europe Kollective (1). Die haben letztendlich die Arbeit noch vervollständigt, weil die ein noch umfangreicheres Projekt über besetzte Häuser in Europa haben. So hat sich das immer mehr erweitert.
G.: Ich verbinde besetzte Häuser in Berlin immer mit den 70er und 80er Jahren. Würdest du sagen, dass das damals die Hochzeit der Hausbesetzerbewegung war?
TG: Es war auf jeden Fall die Zeit, in der es eine Hausbesetzungsbewegung gab, die auch in andere Bewegungen eingebettet war, wie die Mietproteste, die es Ende der 70er/Anfang der 80er gab. Es war auf alle Fälle Teil einer breiten gesellschaftlichen Bewegung. In den 90ern gab es auch wahnsinnig viele Besetzungen. Die waren aber weniger in gesellschaftliche Kämpfe eingebunden. Es war eher Teil einer staatspolitischen Initiative.
Aber jetzt gerade ist ja auch wieder so eine Art Hochzeit. Es gibt zwar weniger Besetzungen, dadurch dass es weniger Leerstand gibt. Aber es gibt wieder wahnsinnig viele stadtpolitische Aktivitäten. Hausbesetzungen sind letztendlich ein Werkzeug und Mittel zum Zweck und nicht nur isoliert zu sehen. Es geht ja nicht nur um Häuser.
G.: Jetzt aktuell gibt es die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule und die Proteste am Kotti. Wie haben sich die Gründe für Hausbesetzungen in den verschiedenen Jahrzehnten geändert?
TG: In den 70ern waren es ja meist Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen, die die Häuser besetzt haben. Die haben das einfach aus der Not heraus gemacht, weil sie keinerlei Treffpunkt hatten, wo sie sich ungestört von Autoritäten, Lehrern, Eltern, Cops treffen konnten.
Das ist ja heute völlig undenkbar, war aber damals offensichtlich so. Da mussten sie aus der Not heraus einfach Häuser besetzen, um solche Räume für sich zu haben, beispielsweise das Rauchhaus, oder das Tommy-Weißbecker-Haus, die gibt es ja heute noch als selbstverwaltete Jugendzentren. In den 80ern gab es wahnsinnig viel Leerstand und gleichzeitig extreme Wohnungsknappheit. Heute gibt es weniger Leerstand, aber ein Riesenproblem, Wohnungen zu bekommen.
G.: Das bezieht sich aber meist auf die Gebiete innerhalb des S-Bahn-Rings, würde ich sagen, aber außerhalb geht das ja noch...
TG: Das ist jetzt vielleicht so, aber Lichtenberg füllt sich gerade auch. Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das bis in die Außenbezirke ausweitet. Von daher sind die Gründe schon ähnlich. Auch das Bedürfnis in einer Stadt präsent zu sein, sich auszutauschen, mit anderen Leuten Protesträume zu schaffen, scheint gerade recht groß zu sein, das ist ja auch nichts Neues.
Die aktuellen Besetzungen sind ja eher Protest-Besetzungen, wie zum Beispiel das Refugee-Camp am Oranienplatz oder Kotti & Co. Die sind ja nicht da, um die Fläche zu haben, die nehmen sich ja Flächen, um in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein und ihren Protest nach außen zu tragen. (Das stimmt so aber auch nicht ganz, die Refugees in der Ohlauer wollten auch einfach da bleiben dürfen. Es geht also auch um fehlende Fläche, um beides: Sichtbarkeit und Platz. Anmerkung der Red.)
G.: Wenn ich an besetzte Häuser denke, fallen mir als erstes bekannte Orte wie die Köpi, das Tommy Haus, das Supamolly ein. Das sind ja auch schon überregional sehr bekannte Häuser, die auch gern von Berlin-Besuchern frequentiert werden. Glaubst du dass eine Karte, wie du sie jetzt online gestellt hast, den Squatting-Tourimus in Berlin nochmal verstärkt? Dass am Thema interessierte Touristen sagen: Ich mach jetzt mal anhand der Seite eine Tour zu den schönsten besetzten Häusern der Stadt?
TG: Klar, aber das ist halt immer ein Problem mit den Besetzungen. Alles, was man im Stadtraum macht und attraktiv ist, zieht ja auch immer neue Leute an. Das ist ja auch das Problem mit der Gentrifizierung. Ich denke schon, dass man gerade linken Subkulturen vorwerfen kann, dass sie der erste Motor der Gentrifizierung waren. Darum geht‘s mir in erster Linie nicht.
Mir ist es eher wichtig, zu zeigen, dass das eine Form von Stärke ist, die man nach außen tragen kann. Dass man zeigen kann, dass es solche Orte gibt und dass in ihnen ein anderes Leben möglich ist. Klar, in jedem Ort, den man regulär mietet, muss man sich nach den Regeln der Marktwirtschaft verhalten. Man muss Eintritt nehmen, man muss teuer Getränke verkaufen, da findet ja auch ein soziales Leben unter ganz anderen Rahmenbedingungen statt. Und das sollte man mit Stolz herzeigen, um zu zeigen: Es geht auch anders. Man kann sich auch anders organisieren, wenn man nur die Scheißmiete nicht hat.
G.: Gab es denn auch Projekte, die ihre Mitarbeit quasi verweigert haben? Die gesagt haben: Wir wollen hier gar nicht öffentlich verzeichnet werden?
TG: Hab ich ehrlich gesagt nicht so gefragt. Aber ich habe nur öffentliche Quellen genommen, von daher bin ich der Meinung, es geht dabei um den öffentlichen Raum und die Öffentlichkeit, und sich der zu entziehen finde ich politisch auch fragwürdig. Klar gibt es Projekte, die nicht im Fokus stehen wollen, aber worum geht es denn dann bei der Besetzung? Um sich sein eigenes kleines Nestchen zu kapern oder ein politisches Zeichen zu setzen?
G.: Also ist eine Besetzung immer ein politisches Zeichen?
TG: Nicht immer, es gibt ja auch stille Besetzungen, aber sobald sie nach außen kommuniziert werden, ist es ein Statement.
G.: Was ich bei den Beschreibungen der besetzten Häuser ganz gut fand, war, dass man da viel über Besetzungen erfährt, von denen ich gar nicht wusste, dass das so möglich war. Heute kennt man ja nur komplett besetzte Häuser. Aber es gab ja auch so Sachen, wo nur einzelne Wohnungen oder auch nur der Dachboden besetzt wurden. Hast du bei deiner Recherche auch was gefunden, was dich besonders überrascht hat?
TG: Schräg fand ich vor allem zu sehen, in welchen Bezirken Besetzungen stattgefunden haben. In Zehlendorf gab es zum Beispiel einen Fall von einem JZ, von dem auch eine Besetzungserklärung dokumentiert ist. Ich habe dann bei der Recherche im Netz rausgefunden, dass da an der gleichen Adresse immer noch ein Jugendzentrum existiert und dass da immer noch komischerweise genau die Sachen stattfinden, die in der Besetzungserklärung gefordert wurden, nur dass kein Wort darüber verloren wird, dass da möglicherweise mal eine Besetzung stattgefunden hat. Das fand ich ganz interessant.
Auch habe ich von Tischlerkollektiven in Lichterfelde Ost erfahren, die es offensichtlich auch noch heute gibt, jetzt aber in Form von Kollektivbetrieben organisiert sind. Und dass es noch relativ starke Strukturen in Charlottenburg gibt. Das hat mich überrascht.
G.: In dem Taz-Artikel über berlin-besetzt.de wurde gemutmaßt, dass Toni Grabowski höchstwahrscheinlich ein Pseudonym sei. Jetzt findet sich aber auf der Homepage eine Handynummer und eine Mail-Adresse. Das sieht für mich nicht so aus, als wolltest du komplett anonym bleiben. Was steckt denn dahinter?
TG: Zunächst sehe ich mich als Teil vom Kunst- und Medienkollektiv Pappsatt (2) und möchte hervorheben, dass ich das Projekt als Teil der Gruppe gemacht habe und persönlich eher zurücktreten will.
G.: Würdest du sagen, dass Berlin durch die Menge an besetzten Häusern einzigartig in dieser Hinsicht in Europa ist – quasi die Hauptstadt der besetzten Häuser?
TG: Berlin ist von daher schon einzigartig, weil es ja die Teilungssituation mit der Mauer hatte. Das ist ja heute kaum vorstellbar, dass Kreuzberg das Ende von Berlin war und keine Sau da wohnen wollte, außer ein paar Leuten, die sich vorm Wehrdienst drücken wollten. Und dass der Rest es eher gemieden hat, da hin zu ziehen, weil es eine schlechte Verkehrsanbindung gab und alle Häuser geschrottet waren. Das hat natürlich in den 80ern eine Situation geschaffen, die es so gar nicht nochmal in einer anderen Stadt gab.
In den 90ern entstand durch den Fall der Mauer dieses Machtvakuum, diese ganzen freien Flächen, die plötzlich da waren. Die von den Besetzern genutzt wurden. Dass die Volkspolizei nicht eingreifen konnten, dass die Westberliner im Osten auch nicht eingreifen konnten, das sind historisch einmalige Situationen aus denen wahnsinnig viel resultiert.
Die Punk-Kultur hat durch die Umstände einen perfekten Platz zum Gedeihen gefunden, die Technokultur genauso. Ich glaube, dass die gesamte Clubkultur aufgrund des ganzen Leerstands und der ganzen Brachen, die illegal bespielt wurden, entstanden ist. Es gab halt so einen Nährboden. Dasselbe kann man über die Graffiti-Kultur sagen. Durch die Mauer gab’s halt viele Mal-Flächen.
G.: Berlin-Besetzt.de ist jetzt seit einiger Zeit online, man kann sich das im Netz anschauen und die Web-Site ist ja eigentlich fertig. Ist das für dich ein abgeschlossenes Projekt oder geht das noch weiter?
TG: Das wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bekomme regelmäßig Zusendungen von weiterem Material, Fotos, auch von Korrekturen. Es werden auch noch viele Lücken vervollständigt. Ich denke, dass in Berlin noch viel passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass es gerade erst der Anfang von einer neuen stadtpolitischen Bewegung ist. Generell denke ich aber, dass die Seite erst ein Anstoß ist für eine Aufarbeitung der Geschichte. Oder vielleicht um ein Bewusstsein zu schaffen, um mal an vergangene stadtpolitische Kämpfe anzuknüpfen. Um mal zu schauen: Was gibt‘s heute, was gab’s damals?
Persönlich ist es für mich deshalb nicht abgeschlossen, weil es für mich und andere Gruppen nur ein Teil einer umfassenderen Arbeit ist. Mit dem Pappsatt-Medienkollektiv arbeiten wir gestalterisch zum Thema Stadtpolitik und Stadtaneignung. Wir gestalten Fassaden, hier am Görlitzer Bahnhof haben wir ein Fassadenbild (3) erstellt für die aktuellen Stadtkämpfe. Es ist so wie ein Spielbrett dargestellt. Zum anderen gibt es jetzt auch eine Printkarte, die im September vor dem Wandbild veröffentlicht wurde. Im September ist auch ein Buch zum Thema „Strategien der Stadtaneignung“ (4) erschienen. Von daher sehe ich es nur als einen Baustein unserer Aktivitäten.
G.: Glaubst du, dass berlin-besetzt.de irgendwann in einen größeren Zusammenhang eingebunden wird, dass es mal eine Weltkarte der besetzten Häuser geben wird?
TG: Könnte es geben, weil die Daten ja jetzt auch für andere Recherchen zur Verfügung stehen. Das Problem sehe ich vielmehr in der Umsetzung. Es ist wahnsinnig schwierig für so ein Projekt Geld zu kriegen. Ich habe selber gemerkt, dass da sehr viel unbezahlte Arbeit drinsteckt.
G.: Letzte Frage: Wer definiert eigentlich, wann ein Haus besetzt ist? Die Besetzer oder die Stadt bzw. der Staat? Die Stadt ist vielleicht schnell dabei zu sagen: Das hier ist besetzt, das räumen wir jetzt...
TG: Wenn man aber andererseits Besetzungen als politischen Akt sieht, definieren es ja schon die Besetzer. Wer weiß, vielleicht weiß der Eigentümer gar nicht, dass er dieses Haus noch hat, das gerade besetzt wird. Trotzdem ist es ein politischer Akt, in ein leerstehendes Haus einzuziehen und das der Öffentlichkeit mitzuteilen.
G.: Toni, vielen Dank für das Interview.
www.berlin-besetzt.de
Gary Flanell
(1) http://sqek.squat.net
(2) www.reclaimyourcity.net
(3) An der Außenwand des Hauses Manteuffelstraße/Naunynstraße, bestens zu sehen vom davorliegenden Spielplatz.
(4) Reclaim Your City: Urbane Protestbewegungen am Beispiel Berlins, Hrsg. vom Pappsatt Medien-Kollektiv, 168 S., Verlag Assoziation A, ISBN 978-3-86241-437-6, 16.00 €
Dieses Blog durchsuchen
Dienstag, 25. November 2014
Dienstag, 18. November 2014
Berlin stirbt
Eine Platte, wie aus der Zeit gefallen, hat letztes Jahr im Renfield-Hauptquartier für einiges Schmachten und Seufzen gesorgt: Das Artwork des Debutalbums von JO STRAUSS sieht aus wie eine Zigarettenwerbung aus den 70ern oder 80ern. Ein junger Mann schaut skeptisch bis Wütend mit einer Kippe in der Hand und über die Schultern geschlagenem Pulli in die Kamera. Die Musik: tief traurige und melancholische Songs in herrlichstem österreichischem Dialekt, so traurig, dass nur der Herbst als Jahreszeit zu diesem Soundtrack passt. Und dann trotzdem immer wieder diese Berlinbezüge da drin, von den Titeln und den Lyrics her. Wie passt das zusammen? Hat da jemand zuviel Hader, Qualtinger und Waits in die Melange gerührt und alles in einem Zug runtergespült? Gute Fragen, die an einem Wochentag – natürlich im Oktober - gestellt werden wollten und in der 27. Printausgabe des RENFIELD-Zines veröffentlicht wurde.
Gary: Hallo Jo, auf der Platte sind ja recht viele Songs mit Berlin-Bezug drauf. Gleich drei tragen Berlin sogar im Titel, darunter Berlin stirbt – woran denn?
Jo Strauss: Der aufmerksame Zuhörer bemerkt, dass es in „Berlin stirbt“ um Parkautoamten geht, die installiert werden. Also eine relativ unspektakuläre Sache. Berlin stirbt wie jede Stadt an den kleinen Veränderungen. Es sind die kleinen Freiräume, die einem da weggeknabbert werden.
Zum Beispiel darfst du heute hier nicht mehr gratis parken und morgen darfst du dort nicht mehr rauchen. In Österreich ist es so, dass man vor dem Bahnhof gar nicht mehr rauchen darf. Obwohl man quasi nicht mehr im Gebäude steht. Man ertappt sich dann dabei, dass man leise zustimmt, von wegen: Ok, ich hab schon Verständnis dafür. Die Stadt braucht ja auch Geld. Ich bezahl halt meine drei Euro fürs Parken. Man stimmt einfach zu, man stimmt so dem Sterben zu. Man sagt so: Ach das bisschen Rauchen, darauf kann ich schon verzichten, rauch ich halt woanders, aber am Ende des Tages wird man darauf kommen, dass man dem Sterben zugestimmt hat.
G.: Also sind es eher die kleinen Veränderungen, die den langsamen Tod herbeiführen?
J.: Eine signifikante Veränderung in Berlin war in Prenzlauer Berg, dass fürs Parken kassiert wird. Das war für mich immer ein großes Plus, dass du in Berlin dafür nichts bezahlst. in Österreich war das ja schon gang und gebe. Ich hab dann erst bemerkt, wie viele von diesen kleinen Freiheiten sterben.
G.: Wie ist das mit dem Nichtrauchen in den Cafés, ist das ein Riesenproblem für dich?
J.: Schwierig. Es geht viel vom Kaffeehausglamour weg. Wenn ich ins Kaffeehaus gehe, will ich ja nicht meine Apfelschorle und meinen frischgepressten O-Saft trinken, sondern ich will ein bisschen Glamour. Und ein bisschen Glamour geht auch mit Zerstörung einher. Wenn man jetzt die Raucher alle verbannt, dann hat man bald kein Kaffeehaus mehr, sondern eher sowas wie einen Zahnarztwartebereich.
Ich will die Raucher nicht in Schutz nehmen, aber ich will diese heiligen Orte in Schutz nehmen. Ich will auch einen Kaffee trinken dürfen und nen Bier und nen Wein, obwohl jeder weiß. dass das nicht gesund ist. So ist es mit dem Rauchen auch. Ich finde, man sollte in heiligen Orten wie Kaffeehäusern rauchen dürfen.
G.: Du hast gesagt, dass du in Berlin wohnst. Wie hat es dich denn von Österreich eigentlich hier hin verschlagen?
J.: Ich habe lange in Österreich gewohnt und habe dann gedacht, ich muss mich bewegen und so hat es mich nach Berlin gezogen. Ich hab viel davon gehört, hatte Bekannte dort und das hat sich angeboten, sprachbarrieretechnisch und finanztechnisch, weil es ja, verglichen mit den anderen großen Städten, leistbar war.
G.: Ich kenne recht viele Österreicher, die von Berlin total begeistert sind. da frag mich mich, man könnte ja als Österreicher auch nach Wien gehen, das ist ja auch eine große Stadt. was ist denn für Österreicher an Berlin so faszinierend?
J.: Wenn man als Österreicher nach Wien geht wird man relativ schnell mit einer Grundstimmung konfrontiert, die nicht angenehm ist. Nämlich der, die alles, was nicht aus Wien kommt, als Provinzler abgestempelt. Das ist vielen Österreichern, die nicht aus Wien kommen, unangenehm. Wenn ich irgendwo hinkomme, und ich habe das Gefühl, ich bin quasi der Bauer aus Wien, dann ist das nicht angenehm. In Berlin wird man als Österreicher mit sehr offenen Armen empfangen. und das ist schon sehr angenehm. In Wien kommt das im Subtext dann schon so ein "Wo kommst du denn her?" mit.
G.: Ja, in Berlin ist das nicht so stark ausgeprägt. Wenn man da aus der deutschen Provinz kommt, dann ist man hier schnell unter seinesgleichen und wird man schnell aufgenommen.
J.: In Berlin ist jeder irgendwann mal zugezogen. Man hat so das Gefühl, dass die Österreicher und Österreich ganz positiv besetzt sind: Da ist man mal in den Urlaub hingefahren, da gibt es eine schöne Landschaft, das sind gemütliche Leute und sowas. Das spürt man.
Es ist halt was anderes, wenn man mal auf den Tisch haut und ernst genommen werden will, dann kann es schon mal sein, dass man als der kleine Bruder wahrgenommen wird, der mal wieder etwas besänftigt werden muss. Wenn man aber interessanterweise ein paar Jahre in Berlin gewohnt hat und kommt dann zurück nach Wien, dann sind die Wiener ganz brav und sagen: Ok, der war ja schon mal in Berlin. Man hat dieses Provinzlerdasein dann quasi abgehäutet.
G.: Die Platte hast du bei Alex Ott in Kreuzberg aufgenommen, wie seid ihr denn zusammengekommen? Was war für dich das Beste an der Arbeit zu den Aufnahmen mit ihm?
J.: Ein österreichischer Freund von mir, ein Musiker, wohnt schon länger als ich in Berlin. Der hat genau neben Alex‘ Studio einen Proberaum und meinte, wenn wir live aufnehmen wollen, ist das ein Tipp für uns. Es war immer eine gute Stimmung und ich hatte das Gefühl, dass Alex den Kern des Projekts erfassen und auf Tonträger bringen will. Spannende, für mich undenkbare und neue Aufnahmetechniken. Wir haben das Ding in nur zwei Tagen reingespielt, wie und warum das möglich war, ist zu einem guten Teil Alex' Verdienst.
G.: Du hast gesagt, dass ihr die Songs live im Studio aufgenommen habt. Warum war es für dich wichtig?
J.: Weil ich will das das so klingt wie in 'Echt'. Wir haben erstmals auch mit Live Monitoring aufgenommen (d.h. nicht jeder hört seinen eigenen Mix über Kopfhörer) sondern tatsächlich so, dass jeder dasselbe hört, weil es einen Speaker im Raum gibt - die minimalen Übersprechungen sind das enorme Plus an 'Feeling' echt wert. Einige Nummern haben wir tatsächlich mit einem Mikro in der Raummitte und einem Gesangsmikro aufgenommen - verrückt ist das eigentlich. Einige der Songs sind 'First takes' - wir waren nicht auf eine aalglatte Produktion aus, wir wollten dass das Ding so klingt wie das 'Gute Schlechte Laune Orchester' und Jo Strauss nun einmal klingen.
G.: Wo wohnst du eigentlich in Berlin?
J.: In Prenzlauer Berg.
T.: Das ist ja auch ein Bezirk, der sich sehr verändert hat und sehr bürgerlich geworden ist...
J.: Der hat sich in den letzten zehn Jahren ganz groß bewegt. Ich kenne Leute die den Prenzlauer Berg vor 20 Jahren beschreiben und das war wild. Jetzt ist das Gefährlichste in Prenzlauer Berg, dass dich ein Kinderwagen überrollt.
G.: Nervt dich das?
J.: Es ist eine Bewegung, die sich hier einfach so ergibt. Man stimmt halt so zu. Man sagt halt: Ok, ich gebe auch zu, dass ich es abends gern ruhig habe. Nur ertappt man sich dann dabei, dass man auch zugestimmt hat, dass die Kneipe am Eck dann zugesperrt hat. Und so verändert sich das. Es tut mir ein bisschen weh, aber ich muss auch gestehen, dass ich zu dieser Bewegung auch beitrage. Man sieht halt da wirklich beim Sterben zu und sagt dann aber auch: Ok, ich zahle halt mal eine Fuffi mehr Miete und spiele quasi das Spiel selber mit...
G.: Wo wir dann wieder beim Thema "Berlin stirbt" wären... Das Schöne, Kreative Unfertige von Berlin bleibt dabei auf der Strecke. Auf deiner Homepage steht als Infotext zu dir und deiner Musik "Schreibt Lieder, die den Menschen das Herz aus der Brust reißen, es auf den Boden schmeißen und dann gehörig darauf herumtrampeln sollen!" Ich finde, das klingt voll hart. Soll man leiden, wenn man deine Musik hört?
J.: Das wurde mir so von einem Journalisten hingedichtet. Ich habe mir da selber noch keine Geschichte zu ausgedacht. Man könnte es so auslegen, dass ein Großteil der Nummern ganz schön daherkommen und dann in den letzten Teilen dann so eine Wendung kriegen, die dann schmerzt. Man hört der Geschichte zu und denkt: Oh wunderschön, wie die so dahinplätschert und am Ende kommt dann eine kleine Wendung rein, die das ganze Ding auf den Kopf stellt. Wo einem das Lachen dann im Hals stecken bleibt.
G.: Das klingt für mich sehr typisch österreichisch, nach sehr schwarzem Humor. Wie wichtig ist der für dich beim Musikmachen und Texte?
J.: Schwarzer Humor ist großartig wichtig. man muss über dir Grausamkeiten schon schmunzeln können. Oder wie es bei Blaubart ist, so das ganz grobe Zeug. So der Geisterbahngrusel. Wir wissen eh, dass es nur ein Spiel ist und jetzt hüpfen wir mal da rein, und gruseln uns mal so richtig, aber nur weil wir wissen, dass es ein Spiel ist.
G.: Als ich die Platte gehört habe, dachte ich: Hmm, es ist ziemlich düster und makaber, aber auch unterhaltsam. Die Songs sind geil, und da singt einer in einem harten österreichischen Dialekt und kommt aus Österreich. Was hältst du in dem Zusammenhang eigentlich von dem Begriff Austropop?
J.: Schwierig. Austropop, wenn man das so hört und ganz eng steckt, ist das irgendwelcher grässlicher Schaum, der oben schwimmt, den man da sieht. Aber in der Tiefe des Austropops gibt es ganz großartige Sachen, die versteht man nicht so unter Austropop. Man denkt da gleich an Fendrich und so. und man sieht nur das dünne zeug, aber es geht im Austropop weit nach unten.
G.: Aber wäre das ein Begriff, ein Genre, das du auf deine Musik anwenden würdest?
J.: Ich glaube ja, weil sich sonst kein Begriff etabliert hat. Wenn man sagt es ist Singer/Songwriter oder Folk, dann wird auch gleich gefragt: Wie, und du singst deutsch? Es gibt keinen richtigen Begriff dafür, deshalb kann ich mit Austropop schon leben. Eben weil ich weiß, dass es da weit in die Tiefe geht.
G.: Ich musste bei vielen Songs auch an das denken, was Tom Waits so auf seinen Platten treibt. Ist der ein Einfluss für dich?
J.: Tom Waits ist auf alle Fälle ein Einfluss, vor allem die Rauheit, wie sie sich im Instrumentalen so findet, habe ich sehr gern. Im Austropop hat man sich dahingehend beispielsweise nie sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass man sagt: Jetzt lassen wir die Band mal so spielen, wie sie spielt und machen da nicht mit dem Bügeleisen drüber alles glatt.
G.: Unter deinen Mails zum Terminfindung für dieses Interview steht in der Signatur immer „Sitzmusik und ein bisschen Kabarett“. Wie kann man sich das live vorstellen?
J.: Es ist tatsächlich so eine Mischung aus Konzert und Kleinkunstabend. Zwischen den Nummern werden immer Geschichten erzählt oder ich erzähle Geschichten zu den Musikern. Es ist oft schon lustig, wenn ich einfach was erzähle, obwohl ich selber manchmal nicht genau weiß, warum.
Ich habe gemerkt, dass es dem Abend sehr dienlich ist. Denn wenn ich in dieser Schwere einen Abend bestreite, ohne was zu sagen, dann denken die Leute nach der dritten Nummer: Was ist das für ein Arschloch? Depressiv, morbid und so?! Das ist ihnen oft zu schwer. Ich erzähle eh gerne was und dann merken die Leute auch: Ah, er ist eh ja doch ein Mensch.
G.: Bei den Texten fand ich sehr interessant, dass du bei den Lyrics ganz ausführliche Fußnoten gesetzt hast. Stand da die Angst im Raum hierzulande nicht von jedem verstanden werden zu können?
J.: Das war auf Geheiß meiner Berliner Freunde hin. Quasi nach der Devise: Mach doch mal eine Übersetzung der Texte, oder hilf uns ein bisschen. Weil es live so ist, dass sie doch gern ein bisschen mehr verstanden hätten. Da haben wir uns aber gesagt, einfach nur zu übersetzen ist auch blöd, weil dann sehr viel verloren ginge und so haben wir Fußnoten drangesetzt, damit die tatsächlich harten Brocken verständlich werden und wir nicht alles übersetzen müssen.
G.: Du studierst Philosophie in Berlin, beeinflusst so ein Studium deine Art Texte zu schreiben oder Musik zu machen?
J.: Es ist nicht ganz vordergründig, aber ich denke, es schleicht sich schon ein. Man blickt auf Dinge ein bisschen anders, wenn man sich mit der Philosophie beschäftigt. Alleine, dass man etwas studiert, wo es hinterher kein Geld zu verdienen gibt, das wirkt sich schon auf die Texte aus.
G.: Das „Berlin stirbt“-Video war das erste, was ich von dir auf YouTube gesehen habe. Ist das Absicht, dass es in einem Video, in dem es um Berlin geht, gar nichts von Berlin sieht?
J.: Absolut. Das ist definitiv so. Weil es ist anwendbar auf alles. Es können sich nicht nur die Städte austauschen, es ist auf alles im Leben anwendbar. Zustimmen zum langsamen Sterben, zur langsamen Veränderung und dann davor stehen: Oh Mist, ich habe das Ding wirklich selber verbockt. Ja, das ist austauschbar. Über Berlin zu singen und dazu Berlinbilder zu zeigen, das ist mir zu sehr straight in the face.
T.: Letzte Frage: Angenommen jemand legt im Kaffeehaus deine CD auf, und möchte sich dazu eine Kaffeespezialität bestellen. welche wäre da am passendsten?
J.: Ein Verlängerter. Schwarz.
G.: Jo, vielen Dank für das Gespräch! www.jo-strauss.at
Gary: Hallo Jo, auf der Platte sind ja recht viele Songs mit Berlin-Bezug drauf. Gleich drei tragen Berlin sogar im Titel, darunter Berlin stirbt – woran denn?
Jo Strauss: Der aufmerksame Zuhörer bemerkt, dass es in „Berlin stirbt“ um Parkautoamten geht, die installiert werden. Also eine relativ unspektakuläre Sache. Berlin stirbt wie jede Stadt an den kleinen Veränderungen. Es sind die kleinen Freiräume, die einem da weggeknabbert werden.
Zum Beispiel darfst du heute hier nicht mehr gratis parken und morgen darfst du dort nicht mehr rauchen. In Österreich ist es so, dass man vor dem Bahnhof gar nicht mehr rauchen darf. Obwohl man quasi nicht mehr im Gebäude steht. Man ertappt sich dann dabei, dass man leise zustimmt, von wegen: Ok, ich hab schon Verständnis dafür. Die Stadt braucht ja auch Geld. Ich bezahl halt meine drei Euro fürs Parken. Man stimmt einfach zu, man stimmt so dem Sterben zu. Man sagt so: Ach das bisschen Rauchen, darauf kann ich schon verzichten, rauch ich halt woanders, aber am Ende des Tages wird man darauf kommen, dass man dem Sterben zugestimmt hat.
G.: Also sind es eher die kleinen Veränderungen, die den langsamen Tod herbeiführen?
J.: Eine signifikante Veränderung in Berlin war in Prenzlauer Berg, dass fürs Parken kassiert wird. Das war für mich immer ein großes Plus, dass du in Berlin dafür nichts bezahlst. in Österreich war das ja schon gang und gebe. Ich hab dann erst bemerkt, wie viele von diesen kleinen Freiheiten sterben.
G.: Wie ist das mit dem Nichtrauchen in den Cafés, ist das ein Riesenproblem für dich?
J.: Schwierig. Es geht viel vom Kaffeehausglamour weg. Wenn ich ins Kaffeehaus gehe, will ich ja nicht meine Apfelschorle und meinen frischgepressten O-Saft trinken, sondern ich will ein bisschen Glamour. Und ein bisschen Glamour geht auch mit Zerstörung einher. Wenn man jetzt die Raucher alle verbannt, dann hat man bald kein Kaffeehaus mehr, sondern eher sowas wie einen Zahnarztwartebereich.
Ich will die Raucher nicht in Schutz nehmen, aber ich will diese heiligen Orte in Schutz nehmen. Ich will auch einen Kaffee trinken dürfen und nen Bier und nen Wein, obwohl jeder weiß. dass das nicht gesund ist. So ist es mit dem Rauchen auch. Ich finde, man sollte in heiligen Orten wie Kaffeehäusern rauchen dürfen.
G.: Du hast gesagt, dass du in Berlin wohnst. Wie hat es dich denn von Österreich eigentlich hier hin verschlagen?
J.: Ich habe lange in Österreich gewohnt und habe dann gedacht, ich muss mich bewegen und so hat es mich nach Berlin gezogen. Ich hab viel davon gehört, hatte Bekannte dort und das hat sich angeboten, sprachbarrieretechnisch und finanztechnisch, weil es ja, verglichen mit den anderen großen Städten, leistbar war.
G.: Ich kenne recht viele Österreicher, die von Berlin total begeistert sind. da frag mich mich, man könnte ja als Österreicher auch nach Wien gehen, das ist ja auch eine große Stadt. was ist denn für Österreicher an Berlin so faszinierend?
J.: Wenn man als Österreicher nach Wien geht wird man relativ schnell mit einer Grundstimmung konfrontiert, die nicht angenehm ist. Nämlich der, die alles, was nicht aus Wien kommt, als Provinzler abgestempelt. Das ist vielen Österreichern, die nicht aus Wien kommen, unangenehm. Wenn ich irgendwo hinkomme, und ich habe das Gefühl, ich bin quasi der Bauer aus Wien, dann ist das nicht angenehm. In Berlin wird man als Österreicher mit sehr offenen Armen empfangen. und das ist schon sehr angenehm. In Wien kommt das im Subtext dann schon so ein "Wo kommst du denn her?" mit.
G.: Ja, in Berlin ist das nicht so stark ausgeprägt. Wenn man da aus der deutschen Provinz kommt, dann ist man hier schnell unter seinesgleichen und wird man schnell aufgenommen.
J.: In Berlin ist jeder irgendwann mal zugezogen. Man hat so das Gefühl, dass die Österreicher und Österreich ganz positiv besetzt sind: Da ist man mal in den Urlaub hingefahren, da gibt es eine schöne Landschaft, das sind gemütliche Leute und sowas. Das spürt man.
Es ist halt was anderes, wenn man mal auf den Tisch haut und ernst genommen werden will, dann kann es schon mal sein, dass man als der kleine Bruder wahrgenommen wird, der mal wieder etwas besänftigt werden muss. Wenn man aber interessanterweise ein paar Jahre in Berlin gewohnt hat und kommt dann zurück nach Wien, dann sind die Wiener ganz brav und sagen: Ok, der war ja schon mal in Berlin. Man hat dieses Provinzlerdasein dann quasi abgehäutet.
G.: Die Platte hast du bei Alex Ott in Kreuzberg aufgenommen, wie seid ihr denn zusammengekommen? Was war für dich das Beste an der Arbeit zu den Aufnahmen mit ihm?
J.: Ein österreichischer Freund von mir, ein Musiker, wohnt schon länger als ich in Berlin. Der hat genau neben Alex‘ Studio einen Proberaum und meinte, wenn wir live aufnehmen wollen, ist das ein Tipp für uns. Es war immer eine gute Stimmung und ich hatte das Gefühl, dass Alex den Kern des Projekts erfassen und auf Tonträger bringen will. Spannende, für mich undenkbare und neue Aufnahmetechniken. Wir haben das Ding in nur zwei Tagen reingespielt, wie und warum das möglich war, ist zu einem guten Teil Alex' Verdienst.
G.: Du hast gesagt, dass ihr die Songs live im Studio aufgenommen habt. Warum war es für dich wichtig?
J.: Weil ich will das das so klingt wie in 'Echt'. Wir haben erstmals auch mit Live Monitoring aufgenommen (d.h. nicht jeder hört seinen eigenen Mix über Kopfhörer) sondern tatsächlich so, dass jeder dasselbe hört, weil es einen Speaker im Raum gibt - die minimalen Übersprechungen sind das enorme Plus an 'Feeling' echt wert. Einige Nummern haben wir tatsächlich mit einem Mikro in der Raummitte und einem Gesangsmikro aufgenommen - verrückt ist das eigentlich. Einige der Songs sind 'First takes' - wir waren nicht auf eine aalglatte Produktion aus, wir wollten dass das Ding so klingt wie das 'Gute Schlechte Laune Orchester' und Jo Strauss nun einmal klingen.
G.: Wo wohnst du eigentlich in Berlin?
J.: In Prenzlauer Berg.
T.: Das ist ja auch ein Bezirk, der sich sehr verändert hat und sehr bürgerlich geworden ist...
J.: Der hat sich in den letzten zehn Jahren ganz groß bewegt. Ich kenne Leute die den Prenzlauer Berg vor 20 Jahren beschreiben und das war wild. Jetzt ist das Gefährlichste in Prenzlauer Berg, dass dich ein Kinderwagen überrollt.
G.: Nervt dich das?
J.: Es ist eine Bewegung, die sich hier einfach so ergibt. Man stimmt halt so zu. Man sagt halt: Ok, ich gebe auch zu, dass ich es abends gern ruhig habe. Nur ertappt man sich dann dabei, dass man auch zugestimmt hat, dass die Kneipe am Eck dann zugesperrt hat. Und so verändert sich das. Es tut mir ein bisschen weh, aber ich muss auch gestehen, dass ich zu dieser Bewegung auch beitrage. Man sieht halt da wirklich beim Sterben zu und sagt dann aber auch: Ok, ich zahle halt mal eine Fuffi mehr Miete und spiele quasi das Spiel selber mit...
G.: Wo wir dann wieder beim Thema "Berlin stirbt" wären... Das Schöne, Kreative Unfertige von Berlin bleibt dabei auf der Strecke. Auf deiner Homepage steht als Infotext zu dir und deiner Musik "Schreibt Lieder, die den Menschen das Herz aus der Brust reißen, es auf den Boden schmeißen und dann gehörig darauf herumtrampeln sollen!" Ich finde, das klingt voll hart. Soll man leiden, wenn man deine Musik hört?
J.: Das wurde mir so von einem Journalisten hingedichtet. Ich habe mir da selber noch keine Geschichte zu ausgedacht. Man könnte es so auslegen, dass ein Großteil der Nummern ganz schön daherkommen und dann in den letzten Teilen dann so eine Wendung kriegen, die dann schmerzt. Man hört der Geschichte zu und denkt: Oh wunderschön, wie die so dahinplätschert und am Ende kommt dann eine kleine Wendung rein, die das ganze Ding auf den Kopf stellt. Wo einem das Lachen dann im Hals stecken bleibt.
G.: Das klingt für mich sehr typisch österreichisch, nach sehr schwarzem Humor. Wie wichtig ist der für dich beim Musikmachen und Texte?
J.: Schwarzer Humor ist großartig wichtig. man muss über dir Grausamkeiten schon schmunzeln können. Oder wie es bei Blaubart ist, so das ganz grobe Zeug. So der Geisterbahngrusel. Wir wissen eh, dass es nur ein Spiel ist und jetzt hüpfen wir mal da rein, und gruseln uns mal so richtig, aber nur weil wir wissen, dass es ein Spiel ist.
G.: Als ich die Platte gehört habe, dachte ich: Hmm, es ist ziemlich düster und makaber, aber auch unterhaltsam. Die Songs sind geil, und da singt einer in einem harten österreichischen Dialekt und kommt aus Österreich. Was hältst du in dem Zusammenhang eigentlich von dem Begriff Austropop?
J.: Schwierig. Austropop, wenn man das so hört und ganz eng steckt, ist das irgendwelcher grässlicher Schaum, der oben schwimmt, den man da sieht. Aber in der Tiefe des Austropops gibt es ganz großartige Sachen, die versteht man nicht so unter Austropop. Man denkt da gleich an Fendrich und so. und man sieht nur das dünne zeug, aber es geht im Austropop weit nach unten.
G.: Aber wäre das ein Begriff, ein Genre, das du auf deine Musik anwenden würdest?
J.: Ich glaube ja, weil sich sonst kein Begriff etabliert hat. Wenn man sagt es ist Singer/Songwriter oder Folk, dann wird auch gleich gefragt: Wie, und du singst deutsch? Es gibt keinen richtigen Begriff dafür, deshalb kann ich mit Austropop schon leben. Eben weil ich weiß, dass es da weit in die Tiefe geht.
G.: Ich musste bei vielen Songs auch an das denken, was Tom Waits so auf seinen Platten treibt. Ist der ein Einfluss für dich?
J.: Tom Waits ist auf alle Fälle ein Einfluss, vor allem die Rauheit, wie sie sich im Instrumentalen so findet, habe ich sehr gern. Im Austropop hat man sich dahingehend beispielsweise nie sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass man sagt: Jetzt lassen wir die Band mal so spielen, wie sie spielt und machen da nicht mit dem Bügeleisen drüber alles glatt.
G.: Unter deinen Mails zum Terminfindung für dieses Interview steht in der Signatur immer „Sitzmusik und ein bisschen Kabarett“. Wie kann man sich das live vorstellen?
J.: Es ist tatsächlich so eine Mischung aus Konzert und Kleinkunstabend. Zwischen den Nummern werden immer Geschichten erzählt oder ich erzähle Geschichten zu den Musikern. Es ist oft schon lustig, wenn ich einfach was erzähle, obwohl ich selber manchmal nicht genau weiß, warum.
Ich habe gemerkt, dass es dem Abend sehr dienlich ist. Denn wenn ich in dieser Schwere einen Abend bestreite, ohne was zu sagen, dann denken die Leute nach der dritten Nummer: Was ist das für ein Arschloch? Depressiv, morbid und so?! Das ist ihnen oft zu schwer. Ich erzähle eh gerne was und dann merken die Leute auch: Ah, er ist eh ja doch ein Mensch.
G.: Bei den Texten fand ich sehr interessant, dass du bei den Lyrics ganz ausführliche Fußnoten gesetzt hast. Stand da die Angst im Raum hierzulande nicht von jedem verstanden werden zu können?
J.: Das war auf Geheiß meiner Berliner Freunde hin. Quasi nach der Devise: Mach doch mal eine Übersetzung der Texte, oder hilf uns ein bisschen. Weil es live so ist, dass sie doch gern ein bisschen mehr verstanden hätten. Da haben wir uns aber gesagt, einfach nur zu übersetzen ist auch blöd, weil dann sehr viel verloren ginge und so haben wir Fußnoten drangesetzt, damit die tatsächlich harten Brocken verständlich werden und wir nicht alles übersetzen müssen.
G.: Du studierst Philosophie in Berlin, beeinflusst so ein Studium deine Art Texte zu schreiben oder Musik zu machen?
J.: Es ist nicht ganz vordergründig, aber ich denke, es schleicht sich schon ein. Man blickt auf Dinge ein bisschen anders, wenn man sich mit der Philosophie beschäftigt. Alleine, dass man etwas studiert, wo es hinterher kein Geld zu verdienen gibt, das wirkt sich schon auf die Texte aus.
G.: Das „Berlin stirbt“-Video war das erste, was ich von dir auf YouTube gesehen habe. Ist das Absicht, dass es in einem Video, in dem es um Berlin geht, gar nichts von Berlin sieht?
J.: Absolut. Das ist definitiv so. Weil es ist anwendbar auf alles. Es können sich nicht nur die Städte austauschen, es ist auf alles im Leben anwendbar. Zustimmen zum langsamen Sterben, zur langsamen Veränderung und dann davor stehen: Oh Mist, ich habe das Ding wirklich selber verbockt. Ja, das ist austauschbar. Über Berlin zu singen und dazu Berlinbilder zu zeigen, das ist mir zu sehr straight in the face.
T.: Letzte Frage: Angenommen jemand legt im Kaffeehaus deine CD auf, und möchte sich dazu eine Kaffeespezialität bestellen. welche wäre da am passendsten?
J.: Ein Verlängerter. Schwarz.
G.: Jo, vielen Dank für das Gespräch! www.jo-strauss.at
Mittwoch, 12. November 2014
Die Uhr, die nicht tickt
„Man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen, nur weil es biologisch möglich ist!“
War das entspannend, dieses Buch zu lesen. Wie der erste Cuba Libre einer langen Nacht oder ein Nachmittag Seriengucken mit meiner Lieblingsfreundin. Oder mit meinem Kind zusammen ganz laut singen. Das sind alles Tätigkeiten, die dazu beitragen, dass ich mich wieder fähig fühle, mit allem klarzukommen, was mir das Leben so an den Kopf werfen mag. Genauso geht es mir nach der Lektüre des neuen Buchs von Sarah Diehl. Es trägt den schönen Titel „Die Uhr, die nicht tickt“. Die biologische nämlich.
Übrigens hat die Renfield-Crew dieses Buch schon von verschiedenen Seiten her angepackt, und so wird Sarah am Donnerstag, dem 13.November um 20.30 Uhr in der SubCult-Radioshow auf Pi-Radio 88,4 ein Gespräch mit Renfield's very own Niki Matita führen.
Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Obwohl diese biopolitische „Streitschrift“ für das kinderlose Glück mir eigentlich gar nicht viel Neues erzählt hat. Die Erfindung der Kleinfamilie, des Mutterbildes und noch anderer Vorstellungen, die viele für selbstverständlich halten: das ist bekannt, wenn man sich je damit beschäftigt hat, das wird alles kurz, klug und nachvollziehbar dargestellt und gezeigt, wie Frauen gezielt politisch und sozial manipuliert werden, um sich schuldig zu fühlen, wenn sie nicht die ihnen zugedachte Rolle übernehmen. Irgendwann wiederholt es sich dann auch ein bisschen.
Inhaltlich ist Sarahs Punkt, dass das Ticken der biologischen Uhr in erster Linie eine gesellschaftliche Forderung ist und dass es ganz einfach eine Menge Leute gibt, die solches nicht verspüren. Die einfach keinen Kinderwunsch haben und keine Lust, sich einreden zu lassen, dass sie das doch sicher noch bereuen würden. Aber eigentlich geht es um etwas anderes bei diesem Buch: Um Solidarität. Deswegen habe ich jetzt nach dem Lesen so gute Laune, und das, obwohl ich schon reichlich Kinder habe und die Unterstützung dabei, mich vielleicht dagegen entscheiden zu wollen, etwas spät kommt.
Indem sie die verschiedenen Frauen erzählen lässt, führt Sarah vor, wie stark die Schuldzuweisung und Ausgrenzung der freiwillig kinderlosen Frau in unserer Gesellschaft tatsächlich ist. Sie wollte ursprünglich auch kinderlose Männer befragen, stellte dabei aber fest, dass diese deutlich weniger von besagter Schuldzuweisung und Ausgrenzung betroffen sind und daher oft gar nicht wussten, was sie zu ihren Fragen sagen sollten, außer, dass sie eben keine Kinder wollen – wo war noch mal das Problem?
Gerade damit macht sie deutlich, wie dringend wir alternative gesellschaftliche Formen brauchen, die nicht nur die freiwillig Kinderlosen, sondern auch die mehrfach ge- und oft überforderten Mamas von dem gesellschaftlichen Druck befreien könnten, dem sie gleichermaßen ausgesetzt sind. Und der sich als schlechtes Gewissen von innen und als Klischeevorstellungen und blöde Fragen von außen manifestiert und uns unnötig das Leben erschwert. Das eigentliche Thema dieses Buches ist die Solidarität, die wir brauchen, um uns eine lebenswerte Gesellschaft aufzubauen, in der es um ein glückliches und erfülltes Leben geht. Und davon werden auch die Kinder nur profitieren, egal, wer sie geboren hat und wer sie erzieht, liebt und für sie sorgt. Darauf den zweiten Cuba Libre einer langen Nacht. Und morgen dann singen auf dem Spielplatz.
Viola Nova Sarah Diehl: Die Uhr, die nicht tickt Arche Literatur Verlag Hardcover 256 Seiten ISBN 978-3-7160-2720-2
War das entspannend, dieses Buch zu lesen. Wie der erste Cuba Libre einer langen Nacht oder ein Nachmittag Seriengucken mit meiner Lieblingsfreundin. Oder mit meinem Kind zusammen ganz laut singen. Das sind alles Tätigkeiten, die dazu beitragen, dass ich mich wieder fähig fühle, mit allem klarzukommen, was mir das Leben so an den Kopf werfen mag. Genauso geht es mir nach der Lektüre des neuen Buchs von Sarah Diehl. Es trägt den schönen Titel „Die Uhr, die nicht tickt“. Die biologische nämlich.
Übrigens hat die Renfield-Crew dieses Buch schon von verschiedenen Seiten her angepackt, und so wird Sarah am Donnerstag, dem 13.November um 20.30 Uhr in der SubCult-Radioshow auf Pi-Radio 88,4 ein Gespräch mit Renfield's very own Niki Matita führen.
Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Obwohl diese biopolitische „Streitschrift“ für das kinderlose Glück mir eigentlich gar nicht viel Neues erzählt hat. Die Erfindung der Kleinfamilie, des Mutterbildes und noch anderer Vorstellungen, die viele für selbstverständlich halten: das ist bekannt, wenn man sich je damit beschäftigt hat, das wird alles kurz, klug und nachvollziehbar dargestellt und gezeigt, wie Frauen gezielt politisch und sozial manipuliert werden, um sich schuldig zu fühlen, wenn sie nicht die ihnen zugedachte Rolle übernehmen. Irgendwann wiederholt es sich dann auch ein bisschen.
Inhaltlich ist Sarahs Punkt, dass das Ticken der biologischen Uhr in erster Linie eine gesellschaftliche Forderung ist und dass es ganz einfach eine Menge Leute gibt, die solches nicht verspüren. Die einfach keinen Kinderwunsch haben und keine Lust, sich einreden zu lassen, dass sie das doch sicher noch bereuen würden. Aber eigentlich geht es um etwas anderes bei diesem Buch: Um Solidarität. Deswegen habe ich jetzt nach dem Lesen so gute Laune, und das, obwohl ich schon reichlich Kinder habe und die Unterstützung dabei, mich vielleicht dagegen entscheiden zu wollen, etwas spät kommt.
Indem sie die verschiedenen Frauen erzählen lässt, führt Sarah vor, wie stark die Schuldzuweisung und Ausgrenzung der freiwillig kinderlosen Frau in unserer Gesellschaft tatsächlich ist. Sie wollte ursprünglich auch kinderlose Männer befragen, stellte dabei aber fest, dass diese deutlich weniger von besagter Schuldzuweisung und Ausgrenzung betroffen sind und daher oft gar nicht wussten, was sie zu ihren Fragen sagen sollten, außer, dass sie eben keine Kinder wollen – wo war noch mal das Problem?
Gerade damit macht sie deutlich, wie dringend wir alternative gesellschaftliche Formen brauchen, die nicht nur die freiwillig Kinderlosen, sondern auch die mehrfach ge- und oft überforderten Mamas von dem gesellschaftlichen Druck befreien könnten, dem sie gleichermaßen ausgesetzt sind. Und der sich als schlechtes Gewissen von innen und als Klischeevorstellungen und blöde Fragen von außen manifestiert und uns unnötig das Leben erschwert. Das eigentliche Thema dieses Buches ist die Solidarität, die wir brauchen, um uns eine lebenswerte Gesellschaft aufzubauen, in der es um ein glückliches und erfülltes Leben geht. Und davon werden auch die Kinder nur profitieren, egal, wer sie geboren hat und wer sie erzieht, liebt und für sie sorgt. Darauf den zweiten Cuba Libre einer langen Nacht. Und morgen dann singen auf dem Spielplatz.
Viola Nova Sarah Diehl: Die Uhr, die nicht tickt Arche Literatur Verlag Hardcover 256 Seiten ISBN 978-3-7160-2720-2
Dienstag, 4. November 2014
100 Jahre Renfield-Post!
Tätääää - der 100. Post auf diesem Blog! Wahnsinn! 100 mal schon was hier reingehackt, geschrieben, getippt, geladen, gelacht, gedacht, weggeworfen, wieder reingesetzt, bearbeitet, vorgeschaut, Tags gesetzt, Labels ausgedacht, die eh keiner liest und so weiter und sofort. Und mindestens schon EINHUNDERTMAL die Statistik angeschaut und mich gefragt, wieso an manchen Tagen drei und manchmal Dreißig Leute aus Tahiti, Alaska, oder Surinam hier reinschauen.
(War nur 'n Witz. Die Weltkarte mit der Anzeige der Besucher aus aller Welt zeigt, das die meisten RENFIELD-Blog-Besucher in Deutschland sitzen, manche in den USA, Frankreich und einige wenige auch in Russland. Um die Crew in Surinam, Tahiti oder den Kayman Islands zu angeln, muss ich mir noch was einfallen lassen. Wer diesbezüglich Ideen hat, melde sich bitte unter renfield-fanzine@hotmail.de).
Aber schön ist es trotzdem. 100 Posts, wer hätte das gedacht. Gott oder eine andere spirituelle Entität vielleicht?
Davon ab: Es geht auf das Ende zu. Aber sowas von fix. Nicht dieser Blog, keine Angst. Bald folgt der Abgrund des Jahres und kippt uns ohne zu fragen über die Klippe in das neue. Heute wurde mir von einem Herrn in Postuniform mitgeteilt, dass in zwei Monaten Weihnachten ist. Stimmt ja gar nicht. In zwei Monaten ist schon alles vorbei und wir haben nicht mal Aschermittwoch. Da schütteln wir noch den Kopf ob des Champagnerschwipses, den wir uns mit Krimsekt einige Tage vorher angetrunken haben. Und wenn alles gut läuft, werden wir uns fragen: 2014 - war da was?
Und wenn alles noch besser läuft, erinnern wir uns an ein paar geile Rezensionen von ein paar geilen Platten, die in einer dunklen Novembernacht auf den RENFIELD-Blog geladen wurden. Nämlich jetzt.
RENFIELD No. 29 erscheint übrigens am 14.11.2014 und wird wieder kräftig gefeiert auf Planet TRX-Zwo-TTA-GAMMA-BETA-Ömelius-Sieben. Ihr wisst eh, wo das ist.
Live mit dabei: PISSE (Karibik-Punk, Berlin)
und die fabelhaften DYSNEABOYS (80ies-Skatepunk von Menschen, die in den 80ern wirklich Skatepunks waren. Auch aus Berlin).
Als DJs konnten desweiteren NIKI MATITA (SubCUlt Radioshow, Renfield-Crew) und
THE UNHOLY SPIDER (TRX-Zwo-TTA-GAMMA-BETA-Ömelius-Siebens very own Schmuckeremit) gewonnen werden.
Weitere Infos auf dem Flyer siehe oben.
Jetzt was ganz anderes - die versprochenen Plattenkritiken nämlich.
KLOTZS – Schwarzer Planet (Tumbleweed records) Platten, in deren Titel das Wort Planet auftaucht, erinnern mich immer an alte Scheiben von Karat oder Peter-Maffay. Das hat sowas 80er-Konzeptalbum-Mäßiges. Klotzs tun schon seit Ewigkeiten rum, der Name taucht immer im Zusammenhang mit EA80, Graf Zahl und Anverwandten auf. Mittlerweile ist man seit Jahren schon als Duo unter Einsatz eines interessanten Bass-Gitarre-Hybrids unterwegs. Nicht eben eine Band, die es nochmal auf die Riesenbühnen eines biergesponserten Festivals schaffen will und muss.
Lange Zeit habe Ich einen Bogen um diese Platte gemacht, keiner weiß warum. Vielleicht weil ich seit geraumer Zeit deutschsprachige Platten eher langweilig finde. Da verstehe ich ja alles. Und ich will gar nicht soviel verstehen. Sechs Songs gibt’s auf der „Schwarzen Planet“, soviel Muße finde ich nun, dass ich mir mal jeden einzeln vornehmen kann:
1. Kopfpunk - klingt an wie eine reduzierte Version von Fugazi mit EA80-Gesang. Dann kommt auch noch der Break, wo ihn auch Ian McCaye gesetzt hätte. Deshalb vorhersehbar ? Nö.
2. Schwarzer Planet I – Titelsong durchnummeriert, steckt da vielleicht doch ein Konzept hinter, mit mehreren Kapiteln? Unverzerrte Klimpergitarre, dann ein halliges Lick. Da spürt man fast die Kälte im Weltall. Hallig auch der EA80-Gesang.
3. Drehtür – der melodischste und optimistischste Song hier im Saal. Einfach ein guter Punksong, knackig und kompakt, mit soviel Melodie wie eine nachdenkliche Punkband halt so kann. Könnte von EA80 (Der Gesang) ODER den BOXHAMSTERS sein.
4. Der Neue Stille – da läuft er, der Bass. Und läuft und läuft und läuft. Fast schon wie bei NoMeansNo, nur mit EA80-Gesang.
5. Schwarzer Planet II – zum zweiten Mal in meiner Umlaufbahn. Wieder so ein verträumtes Gitarrenthema am Anfang, danach geht‘s hübsch monoton weiter, als wäre das hier der Soundtrack zu Dark Star, von JOY DIVISION geschrieben. Mag ich deshalb sehr gern. Und den EA80-Gesang auch.
6. Fliehkraft – lustiger Titel am Ende. Hat der was mit dem planetoiden Plattentitel zu tun? Nicht gerade fröhlich, weder von den Akkorden noch vom Text her. Hübsch. Zum Gesang sage ich nichts. (F) Gary Flanell
LYNX LYNX – Trailer Park (Off Label Rec.) Falsches Jahrzehnt schon wieder, aber das macht ausnahmsweise nichts. Und dass die 60er rückblickend roundabout scheiße und schuld an allem sind, soll ja nicht hindern, sich den einen oder anderen Klang aus der Zeit zu leihen und ihn schön schrammelig zu recyclen. Macht Boa schließlich auch und verdient damit sogar Knete. Danke für den Titeltrack der fünfliedrigen EP. Ist man mal unpassend gut drauf, etwa als Rettungssanitäter oder Profiverfasser von Kondolenzanzeigen, hört man sich das Stück ein, zwei Mal an und ist wieder angemessen mies drauf. Keine Liebe im Trailerpark Teutschland! No news, aber auch nicht erfreulich. Wahrscheinlich Nachwirkungen der bigotten 60er. Philip Nussbaum
HÄXXAN – LP ( Heroic Leisure Rec.) Zweimal anhören hilft manchmal. Auch im Fall dieser israelischen Garagerockband, die zusammen mit den nicht weniger guten New Swears in meinem liebsten Schnapsloch gespielt haben. Im direkten Vergleich fand ich sie erstmal nicht so spannend. Aber dann kam die zweite Anhörung. Sie sind vielleicht nicht ganz so filigran wie ihre Tourkollegen, aber hier regiert die gute alte raue Stooges-Schule. Bratzige Gitarren, ein Schreihals, der nicht nervt und glattgebügelt wurde hier soundmäßig auch nichts. Könnte man in der Rollerdisco zwischen Mudhoney und Mrs. Magician laufen lassen und es würde immer noch die gleiche Meute auf der Tanzfläche ausflippen. Großartiges Coverartwork auch. (G) Gary Flanell
LATENZ-COMPILATION#2 (Latenz Records) Labelsampler, Labelsampler, Labelsamp-ler … Sinniger wird’s nicht, wenn man es wiederholt. Wie viel Rezi gibts für einen, den man für €2 kaufen oder für nix runterladen kann, hehehe? Da wir alle nichts als völlig korrupt und nur noch verroht sind, selbstverständlich nicht viel. Muss aber auch nicht, denn was man bei LATENZ in Bremen macht, ist schlicht und ergreifend fein. Was hindert eigentlich all die anderen, sich ein wenig zusammenzurotten und den Kram, der sich dabei ansammelt, in die Welt zu schütten? Gut, vielerlei, ist klar. Geldgeilheit, Narzismus, Angst, und bestimmt auch die nicht zu unterschätzende Phlegmatik. Schön blöd, aber sehr hip. LATENZ muss sich um solchen Dreck nicht kümmern, schon gar nicht für den Hungerlohn. Abgespeckte, unprätentiöse Zusammenstellung von Unterschiedlichstem, ab und an etwas zu Dadalastigem. Fein, wie gesagt. Philip Nussbaum
V.A. TOTALLY WIRED – 010-2013 (totallywiredrecords.com) Labelsampler sind per se ein Ärgernis, schon mal gehört? Schamloses Restficken, ein, zwei Perlchen allenfalls dabei, als Kundenmagnet und Musitourifalle, und das war’s dann. 010-2013 – warum soll ich mich mit dem Ding überhaupt befassen? a) bis Umlaut): Keine Ahnung, aber TOTALLY WIREDs zweite (inzwischen gibts drei) Werkschau ist ein wunderbar vielgeschmackiges Schlaraffenland, und was bei anderen Plattenschmiedenschnellimbissen vielleicht noch unverblümtes Wieder-verwerten und Auskack-resten-in-der-schüsselgoldmachenachwennsdochsoeinfachginge sein mag, ist bei den Wienern ein Schmankerl, ein amuse-gueule, ein unverbindlicher, aber freundlicher Gruß aus der Küche, noch bevor die Tageskarte überhaupt in die Sicht geschoben wurde. Welcome to Lofi- und Irrsinnsheaven! Bei TOTALLY WIRED ist das Menu noch überschaubar, es geht also noch, sich ein hübsches Gesamtfresspaket schicken zu lassen (order @ totallywiredrecords.com). Nieder mit der Sinnenfeindlichkeit, und ein Hoch auf diese Scheißlabelsampler! Philip Nussbaum
REVERSE COWGIRLS – Bucking (Off Label Records) Drei Artverwandte fallen mir ein, mit denen diese Eher-Boys-als-Cowgirls auf Tour schicken würde: Hank Williams III., Bob Wayne oder THE WALTONS. Cow-Punk als Genre war ja mehr so ein 80er-Ding und wurde hie und da dann auch schnell von durchgeknallten Psychobillys geschätzt. Vielleicht, weil#s ähnlich fix zuging und hohes Tempo liegt auch den REVERSE COWGIRLS. Die ersten drei Songs peitscht man so schnell durch, als wollte man vorm vierten Song noch fix die Kühe zwischen Venlo und Breda von der Weide kriegen. Danach wird es etwas relaxter, aber zwisschendurch zieht man immer wieder mal das Tempo an. Besonders feinsinnig ist das zwar alles nicht, aber so eine gewisse Rustikalität ist ja auch gern mal beruhigend. Dürfte nicht nur bei sauffreudiger Landjugend Anklang finden, sondern auch bei dem einen oder anderen Großstadtcowboy. Und mit Hinblick auf den ersten Satz dieser Rezension bleibt nur eins zu sagen: Sofort auf Tour mit denen! (H) Gary Flanell
TERRORGRUPPE – Inzest im Familiengrab (Destiny) Back to the Rotz. Die einzig wahre Terrorgruppe betritt mit viel O-o-oooh das beinah schon gewesene Jahr 2014. Kein Erdbeben, keine Sturmflut, nur ein wenig Verkehrschaos vor der Oldiedisse, aber was ist daran falsch? Nix, genau. Schnauze halten, weitertrinken. Alles neu, Vollbärte für jeden und testikelabkneifende Hosen – das können die jungen Berliner gerne in der Summe für sich alleine haben. Der Rest kommt gut damit klar, das olle bekotzte Motivshirt über der Balkonbrüstung auszuschütteln und kurz aufzubügeln. Unbedingt schick genug. Jacho (Beste Grüße!) und Konsorten haben wohl schon mal etwas breiter die bekannte Mucke verblasen, und auch die Mische aus ironie-infizierten Kommentaren zur Zeit und blankem Blödsinn wirkt ein wenig instant, aber Hauptsache, dieses eigene Genre des Terrorgruppenpunk bleibt der Hauptsachenstadt erhalten und lässt sie nicht alleine mit sich pseudoverkünstlernden Comicfiguren wie den Ärzten etc. (2x P, eins davon auf jeden Fall für das phantastische Zeichentrickbooklet; ach, was soll‘s, noch eins für die Sache an sich) Philip Nussbaum
JOHN SCHOOLEY – The man who rode the mule around the world
(Voodoo Rhythm Records) Sie scheinen den John Schooley bei Voodoo Rhythm wirklich zu mögen. Hätten ja sonst nicht schon das dritte Album von ihm an den Start gebracht. Ist aber auch zu sympathisch, dieses One-man-Band mit allem was klassischerweise dazugehört: Gitarre, Bass-Drum, Harmonika, Einflüsse aus Blues und Country, hoher Trashfaktor und viele Verweise auf die erklärten Vorbilder R.L. Burnside und Hasel Adkins. So kommt eine ganz solide, schwungvolle Trash-Punkscheibe zustande. Die ganze Platte kann man ganz wunderbar in einem Rutsch durchhören (was hier mehrfach passiert ist), würde ich jedoch nach meinem favorisierten Song gefragt, würde ich wohl so bescheiden gucken wie der Esel auf Weltreise. Was es mit dem eigentlich auf sich hat und wer der Mann ist, der ihn geritten hat – bleibt das Geheimnis von John Schooley. (K) Gary Flanell
TALCO – 10 Years-Live in Iruna (Destiny) „Grönemeyer tut es. Die Ärzte tun. BAP tun es, die Broilers tun es. Helene Fischer tut es, Hirte-Blasebalg tut es. Tja, und die Talcos tun es hiermit auch, das habt ihr jetzt davon. Hier kommt das daskriegenwirschockgefrostet, weihnachtenfindetdochstatt“- Livealbum. Weißt du noch? Und ich so, rausgehoppster Tetrapackwein mit Konsumbierschaumkrone überall, du so, lach lach, voll die aufgeplatzten Sonnenbrandblattern und am Hoden-sack einen Knutschfleck, und dann du so, und ich direkt nochmal, weißt du noch? Hä? Nö. Livealben braucht kein Mensch.
Höchstens du, um dich zu erinnern, dass du deinen dicken Hintern schon lange nicht mehr von der Couch gehievt und dich mal irgendwohin begeben hast. (2x P für zwei pipivolle Augen, die der Teenagerliebe nachgrienen) Philip Nussbaum
WOLF-FACE – Still a son of a bitch (Mooster Records) Biertrinkende Buddies, sich verschwitzt in den Armen liegend. Gemeinsam ein paar Hits von HWM, Anti-Flag oder Rise Against gröhlend. Kumpel-Mucke. Flanellhemden und Unterarmtattoos noch eins, so könnte ein Abend mit WOLF-FACE aussehen. Normalerweise nicht das, was ich den Soundtrack meines Alltagslebens nenne, aber das hier kann einiges. Vielleicht weil einfach durchschimmert, dass sich diese Typen aus Chicago gar nicht zu ernst nehmen. Ist jetzt auch kein Fun-Punk, aber es scheint ein gewisser versoffener Witz durch, zumindest in Songs wie „I wanna be a Homo (sapien)“ oder „I am a girlfriend“. Die Haudrauf-version der Gender-Diskussion. Nichts für reflektierte Abende, mehr was für die Nächte mit der Wodka-und-Bier-Sintflut und stundenlangen Freund-schaftsbeschwörungen. Geht ok. (H) Gary Flanell
(War nur 'n Witz. Die Weltkarte mit der Anzeige der Besucher aus aller Welt zeigt, das die meisten RENFIELD-Blog-Besucher in Deutschland sitzen, manche in den USA, Frankreich und einige wenige auch in Russland. Um die Crew in Surinam, Tahiti oder den Kayman Islands zu angeln, muss ich mir noch was einfallen lassen. Wer diesbezüglich Ideen hat, melde sich bitte unter renfield-fanzine@hotmail.de).
Aber schön ist es trotzdem. 100 Posts, wer hätte das gedacht. Gott oder eine andere spirituelle Entität vielleicht?
Davon ab: Es geht auf das Ende zu. Aber sowas von fix. Nicht dieser Blog, keine Angst. Bald folgt der Abgrund des Jahres und kippt uns ohne zu fragen über die Klippe in das neue. Heute wurde mir von einem Herrn in Postuniform mitgeteilt, dass in zwei Monaten Weihnachten ist. Stimmt ja gar nicht. In zwei Monaten ist schon alles vorbei und wir haben nicht mal Aschermittwoch. Da schütteln wir noch den Kopf ob des Champagnerschwipses, den wir uns mit Krimsekt einige Tage vorher angetrunken haben. Und wenn alles gut läuft, werden wir uns fragen: 2014 - war da was?
Und wenn alles noch besser läuft, erinnern wir uns an ein paar geile Rezensionen von ein paar geilen Platten, die in einer dunklen Novembernacht auf den RENFIELD-Blog geladen wurden. Nämlich jetzt.
RENFIELD No. 29 erscheint übrigens am 14.11.2014 und wird wieder kräftig gefeiert auf Planet TRX-Zwo-TTA-GAMMA-BETA-Ömelius-Sieben. Ihr wisst eh, wo das ist.
Live mit dabei: PISSE (Karibik-Punk, Berlin)
und die fabelhaften DYSNEABOYS (80ies-Skatepunk von Menschen, die in den 80ern wirklich Skatepunks waren. Auch aus Berlin).
Als DJs konnten desweiteren NIKI MATITA (SubCUlt Radioshow, Renfield-Crew) und
THE UNHOLY SPIDER (TRX-Zwo-TTA-GAMMA-BETA-Ömelius-Siebens very own Schmuckeremit) gewonnen werden.
Weitere Infos auf dem Flyer siehe oben.
Jetzt was ganz anderes - die versprochenen Plattenkritiken nämlich.
KLOTZS – Schwarzer Planet (Tumbleweed records) Platten, in deren Titel das Wort Planet auftaucht, erinnern mich immer an alte Scheiben von Karat oder Peter-Maffay. Das hat sowas 80er-Konzeptalbum-Mäßiges. Klotzs tun schon seit Ewigkeiten rum, der Name taucht immer im Zusammenhang mit EA80, Graf Zahl und Anverwandten auf. Mittlerweile ist man seit Jahren schon als Duo unter Einsatz eines interessanten Bass-Gitarre-Hybrids unterwegs. Nicht eben eine Band, die es nochmal auf die Riesenbühnen eines biergesponserten Festivals schaffen will und muss.
Lange Zeit habe Ich einen Bogen um diese Platte gemacht, keiner weiß warum. Vielleicht weil ich seit geraumer Zeit deutschsprachige Platten eher langweilig finde. Da verstehe ich ja alles. Und ich will gar nicht soviel verstehen. Sechs Songs gibt’s auf der „Schwarzen Planet“, soviel Muße finde ich nun, dass ich mir mal jeden einzeln vornehmen kann:
1. Kopfpunk - klingt an wie eine reduzierte Version von Fugazi mit EA80-Gesang. Dann kommt auch noch der Break, wo ihn auch Ian McCaye gesetzt hätte. Deshalb vorhersehbar ? Nö.
2. Schwarzer Planet I – Titelsong durchnummeriert, steckt da vielleicht doch ein Konzept hinter, mit mehreren Kapiteln? Unverzerrte Klimpergitarre, dann ein halliges Lick. Da spürt man fast die Kälte im Weltall. Hallig auch der EA80-Gesang.
3. Drehtür – der melodischste und optimistischste Song hier im Saal. Einfach ein guter Punksong, knackig und kompakt, mit soviel Melodie wie eine nachdenkliche Punkband halt so kann. Könnte von EA80 (Der Gesang) ODER den BOXHAMSTERS sein.
4. Der Neue Stille – da läuft er, der Bass. Und läuft und läuft und läuft. Fast schon wie bei NoMeansNo, nur mit EA80-Gesang.
5. Schwarzer Planet II – zum zweiten Mal in meiner Umlaufbahn. Wieder so ein verträumtes Gitarrenthema am Anfang, danach geht‘s hübsch monoton weiter, als wäre das hier der Soundtrack zu Dark Star, von JOY DIVISION geschrieben. Mag ich deshalb sehr gern. Und den EA80-Gesang auch.
6. Fliehkraft – lustiger Titel am Ende. Hat der was mit dem planetoiden Plattentitel zu tun? Nicht gerade fröhlich, weder von den Akkorden noch vom Text her. Hübsch. Zum Gesang sage ich nichts. (F) Gary Flanell
LYNX LYNX – Trailer Park (Off Label Rec.) Falsches Jahrzehnt schon wieder, aber das macht ausnahmsweise nichts. Und dass die 60er rückblickend roundabout scheiße und schuld an allem sind, soll ja nicht hindern, sich den einen oder anderen Klang aus der Zeit zu leihen und ihn schön schrammelig zu recyclen. Macht Boa schließlich auch und verdient damit sogar Knete. Danke für den Titeltrack der fünfliedrigen EP. Ist man mal unpassend gut drauf, etwa als Rettungssanitäter oder Profiverfasser von Kondolenzanzeigen, hört man sich das Stück ein, zwei Mal an und ist wieder angemessen mies drauf. Keine Liebe im Trailerpark Teutschland! No news, aber auch nicht erfreulich. Wahrscheinlich Nachwirkungen der bigotten 60er. Philip Nussbaum
HÄXXAN – LP ( Heroic Leisure Rec.) Zweimal anhören hilft manchmal. Auch im Fall dieser israelischen Garagerockband, die zusammen mit den nicht weniger guten New Swears in meinem liebsten Schnapsloch gespielt haben. Im direkten Vergleich fand ich sie erstmal nicht so spannend. Aber dann kam die zweite Anhörung. Sie sind vielleicht nicht ganz so filigran wie ihre Tourkollegen, aber hier regiert die gute alte raue Stooges-Schule. Bratzige Gitarren, ein Schreihals, der nicht nervt und glattgebügelt wurde hier soundmäßig auch nichts. Könnte man in der Rollerdisco zwischen Mudhoney und Mrs. Magician laufen lassen und es würde immer noch die gleiche Meute auf der Tanzfläche ausflippen. Großartiges Coverartwork auch. (G) Gary Flanell
LATENZ-COMPILATION#2 (Latenz Records) Labelsampler, Labelsampler, Labelsamp-ler … Sinniger wird’s nicht, wenn man es wiederholt. Wie viel Rezi gibts für einen, den man für €2 kaufen oder für nix runterladen kann, hehehe? Da wir alle nichts als völlig korrupt und nur noch verroht sind, selbstverständlich nicht viel. Muss aber auch nicht, denn was man bei LATENZ in Bremen macht, ist schlicht und ergreifend fein. Was hindert eigentlich all die anderen, sich ein wenig zusammenzurotten und den Kram, der sich dabei ansammelt, in die Welt zu schütten? Gut, vielerlei, ist klar. Geldgeilheit, Narzismus, Angst, und bestimmt auch die nicht zu unterschätzende Phlegmatik. Schön blöd, aber sehr hip. LATENZ muss sich um solchen Dreck nicht kümmern, schon gar nicht für den Hungerlohn. Abgespeckte, unprätentiöse Zusammenstellung von Unterschiedlichstem, ab und an etwas zu Dadalastigem. Fein, wie gesagt. Philip Nussbaum
V.A. TOTALLY WIRED – 010-2013 (totallywiredrecords.com) Labelsampler sind per se ein Ärgernis, schon mal gehört? Schamloses Restficken, ein, zwei Perlchen allenfalls dabei, als Kundenmagnet und Musitourifalle, und das war’s dann. 010-2013 – warum soll ich mich mit dem Ding überhaupt befassen? a) bis Umlaut): Keine Ahnung, aber TOTALLY WIREDs zweite (inzwischen gibts drei) Werkschau ist ein wunderbar vielgeschmackiges Schlaraffenland, und was bei anderen Plattenschmiedenschnellimbissen vielleicht noch unverblümtes Wieder-verwerten und Auskack-resten-in-der-schüsselgoldmachenachwennsdochsoeinfachginge sein mag, ist bei den Wienern ein Schmankerl, ein amuse-gueule, ein unverbindlicher, aber freundlicher Gruß aus der Küche, noch bevor die Tageskarte überhaupt in die Sicht geschoben wurde. Welcome to Lofi- und Irrsinnsheaven! Bei TOTALLY WIRED ist das Menu noch überschaubar, es geht also noch, sich ein hübsches Gesamtfresspaket schicken zu lassen (order @ totallywiredrecords.com). Nieder mit der Sinnenfeindlichkeit, und ein Hoch auf diese Scheißlabelsampler! Philip Nussbaum
REVERSE COWGIRLS – Bucking (Off Label Records) Drei Artverwandte fallen mir ein, mit denen diese Eher-Boys-als-Cowgirls auf Tour schicken würde: Hank Williams III., Bob Wayne oder THE WALTONS. Cow-Punk als Genre war ja mehr so ein 80er-Ding und wurde hie und da dann auch schnell von durchgeknallten Psychobillys geschätzt. Vielleicht, weil#s ähnlich fix zuging und hohes Tempo liegt auch den REVERSE COWGIRLS. Die ersten drei Songs peitscht man so schnell durch, als wollte man vorm vierten Song noch fix die Kühe zwischen Venlo und Breda von der Weide kriegen. Danach wird es etwas relaxter, aber zwisschendurch zieht man immer wieder mal das Tempo an. Besonders feinsinnig ist das zwar alles nicht, aber so eine gewisse Rustikalität ist ja auch gern mal beruhigend. Dürfte nicht nur bei sauffreudiger Landjugend Anklang finden, sondern auch bei dem einen oder anderen Großstadtcowboy. Und mit Hinblick auf den ersten Satz dieser Rezension bleibt nur eins zu sagen: Sofort auf Tour mit denen! (H) Gary Flanell
TERRORGRUPPE – Inzest im Familiengrab (Destiny) Back to the Rotz. Die einzig wahre Terrorgruppe betritt mit viel O-o-oooh das beinah schon gewesene Jahr 2014. Kein Erdbeben, keine Sturmflut, nur ein wenig Verkehrschaos vor der Oldiedisse, aber was ist daran falsch? Nix, genau. Schnauze halten, weitertrinken. Alles neu, Vollbärte für jeden und testikelabkneifende Hosen – das können die jungen Berliner gerne in der Summe für sich alleine haben. Der Rest kommt gut damit klar, das olle bekotzte Motivshirt über der Balkonbrüstung auszuschütteln und kurz aufzubügeln. Unbedingt schick genug. Jacho (Beste Grüße!) und Konsorten haben wohl schon mal etwas breiter die bekannte Mucke verblasen, und auch die Mische aus ironie-infizierten Kommentaren zur Zeit und blankem Blödsinn wirkt ein wenig instant, aber Hauptsache, dieses eigene Genre des Terrorgruppenpunk bleibt der Hauptsachenstadt erhalten und lässt sie nicht alleine mit sich pseudoverkünstlernden Comicfiguren wie den Ärzten etc. (2x P, eins davon auf jeden Fall für das phantastische Zeichentrickbooklet; ach, was soll‘s, noch eins für die Sache an sich) Philip Nussbaum
JOHN SCHOOLEY – The man who rode the mule around the world
(Voodoo Rhythm Records) Sie scheinen den John Schooley bei Voodoo Rhythm wirklich zu mögen. Hätten ja sonst nicht schon das dritte Album von ihm an den Start gebracht. Ist aber auch zu sympathisch, dieses One-man-Band mit allem was klassischerweise dazugehört: Gitarre, Bass-Drum, Harmonika, Einflüsse aus Blues und Country, hoher Trashfaktor und viele Verweise auf die erklärten Vorbilder R.L. Burnside und Hasel Adkins. So kommt eine ganz solide, schwungvolle Trash-Punkscheibe zustande. Die ganze Platte kann man ganz wunderbar in einem Rutsch durchhören (was hier mehrfach passiert ist), würde ich jedoch nach meinem favorisierten Song gefragt, würde ich wohl so bescheiden gucken wie der Esel auf Weltreise. Was es mit dem eigentlich auf sich hat und wer der Mann ist, der ihn geritten hat – bleibt das Geheimnis von John Schooley. (K) Gary Flanell
TALCO – 10 Years-Live in Iruna (Destiny) „Grönemeyer tut es. Die Ärzte tun. BAP tun es, die Broilers tun es. Helene Fischer tut es, Hirte-Blasebalg tut es. Tja, und die Talcos tun es hiermit auch, das habt ihr jetzt davon. Hier kommt das daskriegenwirschockgefrostet, weihnachtenfindetdochstatt“- Livealbum. Weißt du noch? Und ich so, rausgehoppster Tetrapackwein mit Konsumbierschaumkrone überall, du so, lach lach, voll die aufgeplatzten Sonnenbrandblattern und am Hoden-sack einen Knutschfleck, und dann du so, und ich direkt nochmal, weißt du noch? Hä? Nö. Livealben braucht kein Mensch.
Höchstens du, um dich zu erinnern, dass du deinen dicken Hintern schon lange nicht mehr von der Couch gehievt und dich mal irgendwohin begeben hast. (2x P für zwei pipivolle Augen, die der Teenagerliebe nachgrienen) Philip Nussbaum
WOLF-FACE – Still a son of a bitch (Mooster Records) Biertrinkende Buddies, sich verschwitzt in den Armen liegend. Gemeinsam ein paar Hits von HWM, Anti-Flag oder Rise Against gröhlend. Kumpel-Mucke. Flanellhemden und Unterarmtattoos noch eins, so könnte ein Abend mit WOLF-FACE aussehen. Normalerweise nicht das, was ich den Soundtrack meines Alltagslebens nenne, aber das hier kann einiges. Vielleicht weil einfach durchschimmert, dass sich diese Typen aus Chicago gar nicht zu ernst nehmen. Ist jetzt auch kein Fun-Punk, aber es scheint ein gewisser versoffener Witz durch, zumindest in Songs wie „I wanna be a Homo (sapien)“ oder „I am a girlfriend“. Die Haudrauf-version der Gender-Diskussion. Nichts für reflektierte Abende, mehr was für die Nächte mit der Wodka-und-Bier-Sintflut und stundenlangen Freund-schaftsbeschwörungen. Geht ok. (H) Gary Flanell
Labels:
Destiny,
Häxxan,
John Schooley,
Klotzs,
Latenz Records,
Lynx,
Mooster Records,
Off Label records,
Reverse Cowgirls,
Talco,
Terrorgruppe,
Totally Wired Records,
Tumbleweed Records,
Voodoo Rhythm,
Wolf-Face
Abonnieren
Posts (Atom)